Verena Güntners „Medulla“ ist ein literarischer Stromstoß, der das Herz trifft und den Kopf beflügelt – eine jener seltenen Lektüren, nach denen die Welt einen halben Ton verschoben wirkt. Güntner schreibt mit vibrierender Genauigkeit und einer sinnlichen Dichte, die alltägliche Gesten in Ereignisse verwandelt. Jeder Satz sitzt, jeder Blickwinkel trägt Bedeutung; doch nie wird das schwer – die Sprache bleibt elastisch, überraschend, federnd. Man liest und fühlt, wie sich die Wahrnehmung schärft, als hätte jemand das Licht im richtigen Moment etwas heller gedreht.
Die Figuren sind keine Schachfiguren eines Plots, sondern atmende Gegenwarten: kantig, fragil, unverhandelbar lebendig. Güntner vertraut ihren Menschen – und uns –, indem sie nicht alles erklärt. Zwischen Zeilen öffnet sich Raum für Ambivalenz, für jenes unerklärliche Knistern, das Literatur von guter Prosa trennt. Wie sie Nähe und Distanz austariert, innere Bewegungen nach außen kehrt und dabei stets zart bleibt, ist bemerkenswert. „Medulla“ wird so zum Resonanzkörper: Man hört nicht nur eine Geschichte, man spürt ihre Nachhallfrequenz.
Thematisch kreist das Buch um Zugehörigkeit und Selbstbehauptung, um die Frage, was von uns bleibt, wenn wir Rollen abstreifen – und wer wir werden, wenn wir den Mut haben, den inneren Kompass nicht mehr zu übertönen. Das ist gesellschaftlich hellwach, aber nie plakativ. Güntner meidet Schlagworte, sie zeigt Zustände. Und genau das macht die Lektüre so gegenwärtig: Man erkennt die feinen Risse – und die Schönheit, die durch sie fällt.
Fazit: „Medulla“ ist kein Roman, den man nebenbei liest. Er zieht einen hinein, fordert die Sinne – und belohnt großzügig. Wer nach Literatur sucht, die sprachlich glänzt, emotional trägt und intellektuell anklingt, sollte hier zugreifen. Danach wird man womöglich ein wenig still – und dann Freunden schreiben: „Lies das.“
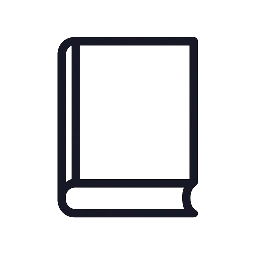
Schreibe einen Kommentar